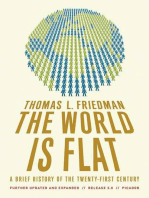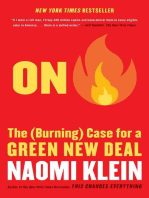Professional Documents
Culture Documents
Cavell - Ereignis PDF
Cavell - Ereignis PDF
Uploaded by
Lucilla Guidi0 ratings0% found this document useful (0 votes)
13 views11 pagesOriginal Title
Cavell- Ereignis.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
Download as pdf
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
13 views11 pagesCavell - Ereignis PDF
Cavell - Ereignis PDF
Uploaded by
Lucilla GuidiCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
Download as pdf
You are on page 1of 11
STANLEY CAVELL
Das Wittgenstein’sche Ereignis
Im Titel dieses Aufsatzes wird ein philosophisches Ereignis mit dem Namen eines
Mannes verbunden. Ich meine damit eine intellektuelle Ziisur, die fiir einige
michtig genug gewesen ist, um ihre Vorstellung von den Méglichkeiten und
Notwendigkeiten der Philosophie umcustiirzen, wihrend sie bei anderen kaum
auf ein Interesse oder doch nur auf ein beschriinktes gestoBen ist, es sei denn, sie
fiihlten sich herausgefordert, einem Werk wie den Philosophischen Untersuchungen
iiberhaupt den Rang einer etnsthaften Philosophie, geschweige denn den einer
unverzichtbaren, zu bestreiten. Obwohl ich diese Zisur in meinem Fall — und
hauptsiichlich dariiber werde ich im Folgenden sprechen — fiir epochal halte,
méchte ich offen lassen, wie stark sich das Ereignis auf unsere umfassendere gei-
stige Kultur ausgewirkt hat, ob es sich erwa au einer, wie Nietzsche sagt, Wasser-
scheide ausgewachsen hat (mir schwebt hier der Gedanke vor, den Nietzsche am
Schluss seiner Unzeitgemiifien Betrachtung iiber Schopenhauer mit den Worten aus
Emersons ,Circles* anfiihrt: ,Bin neuer Grad der Kultur wiirde augenblicklich
das ganze System menschlicher Bestrebungen einer Umwilzung unterwerfen"),
oder ob wir nicht eher das von Wittgenstein den Philosophisehen Untersuchungen
vorangestellte Motto erstnehmen sollten: ,Uberhaupt hat der Fortschrite das an
sich, da er viel gréGer ausschaut als er wirklich ist". Damit sind wir geradem
herausgefordert, das zu betrachten, was man den Stil der Philosophischen Untersu-
chungen nennen kénnte, des einzigen Werkes von Wittgenstein, das ich im Fol-
genden thematisieren mochte. Es sieht so aus, als legte der Text es nach Keiften
darauf an, sich innerhalb der philosophischen Profession reizvoll zu machen und
augleich mit jeder Tradition zu brechen — vielleiche Lisst sich so seine Verfiih-
rungskraft chatakterisieren, fiir einige eine bewundernswerte, philosophische, fiir
andere cine beklagenswerte Eigenschaft.
In diesem Lichte gesehen tiberrascht es kaum, dass mit den Philosophischen
Untersuchungen kein unbestrittener Bildungswert verbunden ist, d. h. dass sie
keinen festen Platz im gegenwirtigen philosophischen Curriculum det Universi-
titen haben. Manchmal scheint es mir vorstellbar, dass man die Untersuchungen
als Teil einer mehr oder weniger chrwiirdigen Traditionslinie. gegen-philoso-
phischer Werke betrachten wird, deren augenfillige Exzentrizitit sicherstellt, dass
sie am Rande eines philosophischen Zentralkanons bleiben, méglicherweise ne-
ben Emersons Essays, Pascals Pensées, Rousseaus Promenades, Friedrich Schlegels
Fragmenten, Kierkegaards Philosophischen Brocken und Niewsches Zarathustra ~
Werke, die unauslischlich das Siegel des Philosophischen tragen, deren Schicksal
aber dennoch grafitenteils davon abhingt, dass sie Leute auBerhalb der akademi-
schen Philosophie interessieren, Eine solche Entwicklung wiirde in meinen Au-
22 STANLEY CAVELL
gen cin heraustagendes Merkmal des Witrgenstein’schen Spitwerks, insbesondere
der Untersuchungen, tibersehen, ein Merkmal, das nicht aufhére mich zu f
ten, nimlich die Forderung, zugleich innerhalb wie auBerhalb der philosophi-
schen Akademie Bestand au haben. In dieser Formulierung liegt die Betonung auf
der adverbialen Bestimmung ,zugleich*: Mit ihr kommt zum Ausdruck, dass et-
was fiir die Faszination des Werkes Wesentliches durch den Versuch verloren
geht, die augenfillig philosophischen Abschnitte, die sich um Fragen der Bedeu-
tung, der Referenz, des Verstehens, der Bewusstseinszustiinde, der Sprachspiele,
der Grammatik usw. drehen, von den offensichtlichen, unverhohlen litetarischen
Selbstbeziigen zu trennen, in denen wir aufgefordere werden, uns mie solchen
Gegenstiinden zu beschiftigen wie in einem Glas gefangenen Fliegen, Kéfern in
Schachteln, Reden eines Lwen und den Ziihnen einer Rose.
Seit ich vor mehr als vierzig Jahren ,The Availability of Wittgenstein’s Later
Philosophy, meinen ersten Aufsatz iiber Wittgenstein, verdffentlicht habe, beto-
ne ich, dass die bemerkenswerte Darstellung seines Philosophierens seiner Lehre
alles andere als duRerlich ist, und vielleicht liegt es vor allem daran, dass und wie
ich dies unauthérlich hervorhebe, dass ich manchmal, mal mehr, mal weniger
wohlwollend als alternative Stimme in der Interpretation des spiiten Wittgenstein
bezeichnet werde, und folglich in dem Mafe als philosophischer Exzentriker. Ei-
nige Jahre lang empfand ich ein trauriges Vergniigen an einer solchen Beschrei-
bung meiner Arbeit, mit der Zeit aber verblasste das Vergniigen und an seine
Stelle trat eine gewisse Ratlosigkeit: Was ist hier eigentlich genau mit ,alternativ"
gemeint, aufgrund welcher Differenz oder welcher Differenzen bin ich Gefahr
gelaufen, dass mein Beitrag nicht als Teil einer gemeinschaftlichen Anstrengung
willkommen geheiGen wurde? Sollee ich je die GroBe dieser Gefahr ermessen, mir
zumindest vor diesem Hintergrund die Reichweite der Skizzen vergegenwiirtigen
wollen, die ich von Teilen des Wittgenstein’schen Werkes, vor allem der Unsersu-
chungen, vorgelegt habe, und sehen, wie sie sich zusammenfligen, dann ist daf
in meinem Alter, sicherlich kein Zeitpunkct giinstiger als der jetzige.
Beginnen méchte ich mit der Selbstberuhigung, dass der Gedanke einer Alter-
native ein gewisses Maf an Gemeinsamkeit enthiilt, etwa das von verschiedenen
Wegen, die zum selben Ziel fiihren, oder von ahnlichen Mitteln zu verschiedenen
Zielen. So darf ich beispielsweise annehmen, dass die von mir vorgebrachten
Thesen iiber das Verhiltnis von Wittgenstein’schen Kriterien zur Vorstellung des
Gewohnlichen und zu der damit einhergehenden Vorstellung von Skeptizismus,
wie sehr sich ihre Schlussfolgerungen auch von anderen Auffassungen unterschei-
den mégen, doch erkennbar sind als cin ziinftig philosophisches Werk. Und ich
darf erwarten, dass irgend etwas Ahnliches auch fiir die Themen gilt, die sich mit
Witegensteins Nicht-Formulieren von Thesen beschifftigen, mit der Zerstérung
alles Interessanten und Wichtigen und mit Unsinn. Ich wei, dass die emphati-
sche, unermiidliche Aufmerksamkeit, die ich auf die Vorstellung des Gewohnli-
chen oder Alltiglichen bei Wittgenstein richte, einigen iibertrieben vorkommt,
und womiglich ist das der Ort, an dem ich meine Differenzen, so wie sie sich mir
darstellen, auf den Punkt bringen kann. Einer meiner Philosophenfreunde, ein
DAS WITTGENSTEIN’SCHE EREIGNIS 23
einflussreicher Bewunderer Wittgensteins, fiihlte sich iiber viele, viele Jahre im-
mer wieder veranlasst, mich darauf zu stoRen, dass Wittgenstein kein Philosoph
der Alltagssprache sei. Fiir mich heifSt das im Wesentlichen, er ist kein Philosoph
vom Schlage J. L. Austins. Doch wenn ich irgend etwas wiederholt bekriftige ha-
be, dann die Unterschiede zwischen ihrer jeweiligen philosophischen Sens
~und der beider zu derjenigen G. E. Moores. Dennoch sche ich Uberschneidun-
gen zwischen mir wichtigen Textpassagen bei Austin und Abschnitten in den
Philosophischen Untersuchungen, die mich zu einer Artikulation ihrer Unterschiede
anstacheln, ae :
‘Wenn Witrgenstein beispielsweise sagt: , Wir fihren die Worter wieder von ih-
rer metaphysischen auf ihre alltigliche Verwendung auriick* (§ 116), ree
kénnte man das eigentlich auch von Austins Praxis behaupten, sieht man mal da-
von ab, dass Austin keinen erklérten Begriff des Metaphysischen, weder in diesem
noch in einem anderen Gewand, hatte und auch keine Geduld damit, und folg-
lich nicht daran interessiert war, die philosophische oder die menschliche Sehn-
sucht nach dem Metaphysischen aufausptiren. (Dieses Inceresse scheint mir hee
cine der vielsagendsten Ahnlichkeiten der Philesphitehen Untersuchungen mit der
Vision der Kritik der reinen Vernunfé zu sein, mit ihrem Gespiir fiir die essentielle,
unerbittliche Ruhelosigkeit des Menschen, ihrem berithmten Sen
als eben dem Vermagen, das der Selbstquilerei verfillt. Der damie einherge rede
Unterschied zu Kant ise Wittgensteins Uberzeugung, dass, wenn i. es - 2
ausdriicken darf, kein Kategotiensystem — nennen wir es eine philosophisch
‘Theorie — eine zuverlissige Zuflucht vor oder Befreiung von dieser Rubel losigkeit
bieten, ihr keine Grenzen zichen kénnte. (Ich habe allerdings keinen See
wie sich diese Uberzeugung beweisen licfe.) Ich denke, hier gibt es cine A ee
‘Wittgensteins zu Schopenhauers Gleichserzung des Dings-an-sich mit dem Wil-
len, der nur durch sich selbst 2 iiberwinden ist.) oe Hattie
Wittgenstein entwickele den Begriff des gewohnlichen oder alltiglichen
Sprachgebrauchs unmittelbar nur wenig weiter, ohne diesen Begriff aber ist oa
weitergespannte Entwicklung oder seine Portriitierung des Metaphyischen a
Sprache (oder des Skeptizismus, fiir Wittgenstein der geistige Zwi lng der
Metaphysik) undurchfiihrbar. (Ich habe behauptet, man kénne ihn mit cea
so groRer oder sogar mehr Berechtigung einen Philosophen der metap vs
schen als der gewdhnlichen Sprache nennen.) Das Gewohnliche trite in den
Philosophischen Untersuchungen wesentlich als das auf, was den Skeptizismus ne
streitet und die Metaphysik transzendiert, gewissermafen als ein fiktiver Ore, der
{im Riickblick) durch die Flucht der Philosophie vor der all ‘iglichen Unbegriin-
detheit, den Vorurteilen und Fixierungen geschaffen wurde. (Ich spiele hier, wie
ich es manchmal tue, auf Platons Hébile als Metapher fiir das Gewohnliche an,
fiir den Ort, an dem die Philosophie beginnt und zu dem sie, anders als die Be-
strebung eines GroRteils der spiteren Philosophie es wollte, sozusagen 2uritck-
kehre.) .
In Austins ,Other Minds" findet sich ein fliichtiger, uncharakteristischer Aus-
bruch, in dem Austin die ,Erbsiinde* beklagt, ,durch die der Philosoph sich
24 STANLEY CAVELL,
selbst aus dem Paradies der Welt, in der wir leben, vertreibe"’. Obgleich damit
etwas von Wittgensteins Eindruck getroffen scheint, dass die Philosophie dazu
neigt, sich auerhalb von Sprachspielen zu artikulieren — und dies tatsichlich be-
zeugt, dass Austin, selbst Austin, mit den Romantikern die fixe Idee vom Mythos
der Vertreibung aus dem Paradies teilt -, fiihre es seitens Austins nicht zu dem
ernsthaften Wunsch, die permanente Selbstnicderlage der Philosophie zu verste-
hen (jedenfalls nicht jenseits der Beschuldigung, sie sei faul, trunken, verschlagen
und ethebe moralisch verdichtige Anspriiche auf Tiefe). Im Gegensatz dazu ent-
werfen die Philosophischen Untersuchungen an einem bestimmten Punkt einen,
wie ich es sche, Gegenmythos zu dem des Paradieses, eine Gegeninterpretation
unserer gegenwirtigen Lage, die zugleich die wiederkehrende Stirke unseres
Drangs, sie zu verlassen, anerkennen soll — als stellten unser Alltagsleben und un-
sere Sprache Grenzen oder eine Korruption des Menschlichen dar — und darauf
hinweist, wie wir in den Schlamassel geraten, wenn wir dem Drang nachgeben.
Dieser Gegenmythos lautet folgendermaen (§ 107): ,Wir sind aufs Glatteis ge-
raten, wo die Reibung fehlt, also die Bedingungen in einem gewissen Sinne ideal
sind, aber wir eben deshalb auch nicht gehen kénnen.“
Welche Gefahr entwichst nun fiir Wittgenstein aus unserer Unfihigkeit zu
gehen? Gehen wird in den Untersuchungen zu det Gruppe von Pahigkeiten ge-
Technet, von denen neben befehlen, fragen, erzihlen, plauschen, essen, trinken
und spielen gesagt wird, sie ,gehdren zu unserer Naturgeschichte" (§ 25) — zu
entdecken oder zu verursachen, dass wir nicht mehr gehen kénnen, kommt dem-
nach einem Bruch in unserer Naturgeschichte gleich. Wir kénnten es die Natur-
geschichte des Menschlichen nennen, nicht unihnlich dem, was Heidegger —
zum Beispiel in dem Aufsatz ,Das Ding" — als die Bedingtheit des Menschlichen
bezeichnet, etwas, das vermutlich verloren gehen oder geleugnet werden kénnte.
Und wie gefihrlich wire nun der Verlust, der aus einem Bruch in unserer
Naturgeschichte entsteht? Wir kinnten uns vorzustellen versuchen, wie wir auf
jemanden reagierten, der immer mal wieder durch angenehme Riume und ent-
{ang sonniger, unblockierter Biigersteige ginge, als waren es Eisfelder oder Wege
entlang eines Abgrunds ~ durch schlichte Flure schlidderte, sich an Hauswiinden
abstiitzte, und doch die ganze Zeit darauf beharrte, et ginge nicht anders als sonst
auch, Miissen wir hier itgendeine Plausibilisierung finden, die weniger oder noch
dringender als im Fall des Schiilers ist, von dem Wittgenstein sich vorstelle, wir
sagten iiber ihn (§ 185): ,Dieser Mensch versteht von Natur aus jenen Befehl, auf
unsere Erklarungen hin, so, wie wir den Befehl: ,Addiere bis 1000 immer 2, bis
2000 4, bis 3000 6, etc.’ “? Selbstverstiindlich fasse ich die Beschreibung ,unfihig
zu gehen“ nicht als Beschreibung eines bestimmten Unvermégens auf, sondern
als etwas, was die Untersuchungen an anderet Stelle einen ,symbolischen Aus-
druck* nennen, der ,eigentlich eine mythologische Beschreibung des Gebrauchs
ciner Regel ist (§ 221), was in diesem Fall wohl etwas iiber unsere Unfahigkeit
1 John 1. Austin, ,Fremdpsychisches",
clam 1986, S. 119f,
ers, Gesammelte philosophische Aufidze, Seutigare: Re-
DAS WITTGENSTEIN’SCHE EREIGNIS 25
aussagt, uns in Ubereinstimmung mit unseren scheinbaren Wiinschen 2u bewe-
gen. (Uber so jemanden kénnten wit sagen, er sei in seinen ,,Glatteisgang" ver-
fallen.) Derartige symbolische Ausdriicke oder Verwendungen sind dort ange-
bracht, wo wir versuchen, unserer Bemithung, unserem Leben einen Sinn 2u ge-
ben, Sinn zu unterlegen, und sie fiihren, etwa wenn wir die Praxis der Regelbe-
folgung erkliren, zu AuBerungen wie ,Die Uberginge sind eigentlich alle schon
gemacht" (§ 219), worunter Wittgenstein eine Gebarde versteht, in der ich aus-
gedriicke habe, wie yes mir vorkomme* — ein Ausdruck, auf den er in der Folge
die Aufmerksamkeit richtet. Indem unsere Forderung nach ciner Idealordaung
der Sprache als der Wunsch mythologisiert wird, ein anderes Medium als eines
mit menschlichem Fundament zu bewohnen, das die menschliche Gangart unter-
stiitzt, entspringt daraus keine geringere Gefahr als die, die Fahigkeit 2u erzihlen,
zu fragen, 2u spielen, 2u essen und zu trinken einzubii®en, und das hei, die Fi-
higkeit zu verlieren, uns auszudriicken oder uns zu nihren, indem wir mit ande-
ren das Brot brechen. Lasst dies schlieSen, dass unser Fundament in der Welt
schwach ist — weil unser Grund uniiberschaubar anfillig fiir unsere Fihigkeit zur
Unzuftiedenheit mit uns ist -, oder ist es eher stark — weil wir nicht wirklich so
weit gehen oder gehen kénnten, den Boden unserer Existenz, unsere Naturge-
schichte, 2u zerstéren?
Diesen Gegenmythos der Flucht, der von einer vermeintlichen Vollkommen-
heit handelt, beendet Wittgenstein mit dem Ausruf: ,Zurtick auf den rauhen Bo-
den!" Es ist ein symbolischer Ausdruck fiir das, was er als Riickfiihrung der Wor-
ter von ihrem metaphysischen auf ihren gewohnlichen Gebrauch beschrieben hat.
Wenn das zutriffe, kann ich weiter spezifizieren, was mein Verstindnis der Wich-
tigkeit des Gewahnlichen oder Alleiglichen in den Untersuchungen von anderen
unterscheider, indem ich niimlich festhalte, dass der buchstablichere Ausdruck flir
die Riickfiihrung der Warter auf ihren Alltagsgebrauch eine Anmerkung zu Wite-
gensteins gerade gefallener Erkkirung (§ 116) ist: , Wenn Philosophen ein Wort
gebrauchen [...] und das Wesen des Dings au erfassen trachten, muf man sich fra-
gen: Wird denn dieses Wort in der Sprache, in der es seine Heimat hat, je tat-
Sichlich so gebraucht?" — cine Bemerkung, in der ich weitere Satze einer Mytho-
logie der menschlichen Ruhelosigkeit oder des menschlichen Strebens entdecke.
Man beachte, dass Wittgenstein hier von Sprache, nicht von Sprachspiel spriche.
Der Eindruck, den wir dann gewinnen, ist nicht der des Philosophen, der sich
nicht an das Sprachspiel des Gewéhnlichen hilt (worauf manch ciner gerne ge-
antwortet hat: Vielleicht tut er es aus guten Griinden), sondern der des Philoso-
phen, der seine Wérter ins Exil schickt.
Das heiftt: unsere Worte. Anders als Austins oder Moores ,Philosoph ist der-
jenige Wittgensteins weniger ein klar identifizierbarer Theoretiker als vielmehr
einer von uns, von Verwirrung ergriffen, in seine Gedanken verstrickt. Nicht wie
Sokrates treten wir ins Erwachsenenleben ein, aber vielleicht wie einer, der er-
staunt ist, dass wir mit unseren Behauptungen Sokrates nicht iiberzeugen. So dass
wir nicht dessen inne sind, wie sehr wir in unserem gewéhnlichen oder, sagen
wit, ,ungepriiften® Leben im Exil von unseren AuSerungen leben, Andere Philo-
26 STANLEY CAVELL,
sophen, darunter Emerson, haben davon geredet, dass wir wie Fremdlinge lebten
oder, besser, in der Entfremdung von unseren eigentlichen Gedanken. Kierke-
gaard sagt, wir lebten, als waren wir ,drauBen', d. b, nicht zu Hause. Wittgen-
stein wird dem hinzufiigen: ,feiernd", Freuds Vorstellung, die eine gewisse Ahn-
lichkeit mit derjenigen Platons im Siaat hat, geht davon aus, dass wir in uns noch
andere stecken haben, die an unserer Stelle sprechen, sozusagen durch unseren
Mund —iibrigens ein Bild, das Wittgenstein ausdriicklich in Erwagung zieht.
Ganz offensichtlich findet dieses mythologische Motiv des Exils seine Fortset-
zung, wenn gesagt wird, die Wérrer seien zuriickeufiihren, und wenn darauf ge-
drungen wird, dass wir selbst zuriickkommen (auf den rauhen Boden). Damit
wird ja auf spezifische Weise zum Ausdruck gebracht, dass wir mit unserem Stau-
nen dariiber, dass ein Sprachspiel angefiihre oder der gewéhnliche Gebrauch eines
Wortes erinnere wird, bereits an dem Ore gewesen sind, 2u dem wir zu gelangen
versuchen. Die Philosophie hat keinen anderen. Wissen wir beispielsweise nicht
schon durch unsere Alleagserfahrung bei meiner Augerung ,Wie er ihren Weg-
gang empfinder, weift ich nur durch das Wenige, was er mir erzihlt und durch-
blicken kisse*, dass meine Zuriickhaltung (,nur") mein Gefiihl andeutet, et ver-
schweige mir etwas, und dass sie beinhaltet, dass ich in diesem Fall kaum iiber
unabhingige Mittel verfiige, um zu erfahren, was er mir verschweigt? Ich kenne
beispielsweise keinen anderen glaubwiirdigen Gewahrsmann, keinen wirklich bes-
seren Weg, um die Sache selbst zu beobachten, Wenn Wittgenstein daher die
philosophische Behauptung, wir kennten andere nur durch ihr Verhalten, krici-
siert (oder besser versuche, uns sehen zu lassen, dass es sich hier um eine philoso-
phisch forcierte Behaupeung handelt), dann fordert er uns zu der Frage auf, ob
wir das Gefiihl unterschreiben michten, der andere verschweige uns immer und
notwendig etwas, und ob wir die Konsequenz bestiitigen wollen, dass ich in allen
Fille tiber keine unabhingigen Mitel verfiige, um 2u wissen, was jener ver-
schweigt. Und wenn wir sagen wollen, dass dies blanker Unsinn sei (,notwendig
verschweigt und keine unabhiingigen Mittel, um es au wissen“, das kann hier
allenfalls bedeuten: Er ist er und ich bin ich — was, wie wichtig es auch sein mag,
keine Information iibermittelt), dann werden wit verstehen wollen, was die Phi-
losophie in den Unsinn treibe. Und wenn es so leicht ist, ins Exil geschickt 2u
werden, wie ist oder wie war dann unser Leben in unserer angeblichen Heimat,
und was heit dann, dorthin ,zurtick“aukehren?
Wie ich den Mythos vom ,Zuriickfiihren der Wérter“ verstche (wir haben das
»Fithren“ hier nicht so interpretiert, als wiren Wérter Iebendig und miissten ge-
fiihre oder gelockt werden), reflektiert er eher die willkommene Vorstellung, dass
die Wetter in den Kreislauf der Sprache und ihre (manchmal unvorhersagbaren)
Projektionen zuriickaufiihren sind, stat auf cine imaginire Funktion fixiere 2u
werden — denn ich bin ja davon ausgegangenen, dass hier nicht daran gedacht
wird, sie an einen Ort zuriickzufiihren. Doch noch hat diese Vorstellung, nicht
cingefangen, in welchem Sinn wir uns in diesem Prozess selbst umkehren miissen.
Das wird nicht durch den Gedanken det ,Riickkehe", sondern den der ,Dre-
hung" deutlich, etwa wenn Wittgenstein sagt: ,Die Betrachtung mu gedreht
DAS WITTGENSTEIN’SCHE EREIGNIS 27
werden, aber um unser eigentliches Bediirfnis als Angelpunkt* (§ 108). Der Zu-
satz ,unser eigentliches Bediitfnis“ hat seinen eigenen Beitrag zur Mythologie zu
leisten, zur Charakterisierung unserer, aus der Perspektive des Philosophen be-
trachteten Alltagsexistenz. Dem Gedanken, dass diese Existenz eine des Exils ist,
fiigt er den Gedanken hinzu, dass sie durch falsche Beditrfnisse oder falsche Not-
wendigkeiten bestimmt ist, so wenn Wittgenstein uns ermahnt oder fordert: ,Sag
nicht: ,Es mu? ihnen etwas gemeinsam sein, sonst hieRen sie nicht Spiele‘ ‘ -
sondern schau, ob ihnen allen etwas gemeinsam ist“ (§ 66).
Die Vorstellung, das menschliche Leben sei durch falsche Notwendigkeiten
gestrt, verbinder die Philosophischen Untersuchungen mit einleitenden Uberle-
gungen in Platons Staat, Rousseaus Contrat social, Thoreaus Walden und Marx’
Kapital und vielleiche zeigt sie, wie man auf den Eindruck reagieren kénnte — vor
dem zu schiitzen ich mich nicht sehr bemiiht habe ~, dass ich bereits viel zu viel
aus Wittgensteins Verlocken zu so genannten metaphilosophischen Bemerkungen
iiber mythologische Beschreibungen und symbolische Ausdriicke gemacht habe,
indem ich betonte, was lerztlich nur ein paar offensichtlich literarische Abschnitte
sind, die in keinem Verhiltnis zu der tatsichlichen philosophischen Arbeit der
Untersuchungen stehen. Offenbar sagt mein Gefiihl, im Gegenteil, dass das was
Wittgenstein als das Mythologische bestimmt, mit einen Ausblick darauf liefert,
was sein philosophisches Werk ist, was er fiir dessen Wichtigkeit halt, wieso es in
der ihm eigenen Weise so schwierig ist, wieso es eben diese Form annimmt, und
in der Verpflichtung, diesen Ausblick au geben, sehe ich etwas, was dem Werk
innewohnt, von ihm gefordert ist. (Wenn ich sage, dass es ,gefordert* ist, dann
michte ich implizieren, dass die Forderung sich begriindet in Frage stellen liisst
und dass man die von mir hervorgehobenen Abschnitte nicht so verinnerlichen
muss, wie ich es getan habe. Damit wiederhole ich nur, worauf ich am Anfang
drang, dass die Arbeit der Untersuchungen zu akademisieren ist und akademisiert
werden sollte — wenngleich zu iiberschaubaren Kosten.)
Es ist ein Werk, das leicht, jedenfalls zeitweilig, 2u trivial erscheint, um gro
dariiber zu sprechen (es lisst uns dariiber nachsinnen, was wir wann sagen, wie
dies méglich und wie schwer es manchmal zu tun ist, und warum es nocwendig
ist), und dann sieht es plétalich so aus, als wiirde eine besonders dringende Ant-
wort von uns verlangt, als wende es sich an ein moralisches Gefiihl oder sogar an
eine religiése Verwunderung, als stiinde die philosophische Befragung der Ver-
wendung cines Wortes in ihrer scheinbaren Trivialitit und in unserem Widet
stand dagegen fiir ein chronisches Gefithl, dass unser Leben auf Messers Schneide
steht und als solches danach verlange, gedreht zu werden. (In den Untersuchungen
trite Philosophie typischerweise in der Folge kleiner, sich wiederholender Krisen
auf, in die das endliche Geschdpf fortgesetat gerit, dieses Geschipf, das belastet
ist — diirfen wir sagen? — mit Gedanken an die Unendlichkeit.) Wenn Wittgen-
stein sich an sich selbst wendet, um zu fragen , Woher nimmt die Betrachtung ih-
re Wichtigkeit, da sie doch nur alles Interessante, d. h. alles Gro®e und Wichtige
zu zerstéren scheint? (§ 118), fiigt er in Klammern hinzu: ,Gleichsam alle Bau-
werke, indem sie nur Steinbrocken und Schutt tibrig life", und stellt, um uns
28 STANLEY CAVELL
darauf aufmerksam zu machen, dass dieser Eindruck unserer Phantasie ent-
springt, dergestalt klar: Keine Bauwerke sind zerstért worden, die Dinge der Welt
sind so, wie sie vorher waren, nur wir sind, in Reaktion auf die triviale Aufforde-
rung, 2u sagen, was wir wissen, aber von dem wit nicht wissen, wie es zu werten
ist, am Boden zerstért. So kann uns eine yon der Philosophie vorangetriebene
Verinderung, in unserem Bewusstsein davon, was interessant, gro® und wichtig,
ist, von einem zum anderen Augenblick ‘iberfallen. Sollten wir da nicht nach ei-
ner Gegenleistung fragen? Vielleicht nach irgendeiner Befteiung? Aber trauen wir
uns zu, zu wissen, wie Befreiung aussieht?
Was ich tiber mein Interesse am Gewohnlichen gesagt habe, ich meine dar-
iiber, dass es das ist, woran wir uns wenden miissen oder gegen das wir uns wen-
den, kénnte ich in der Behauptung zusammenfassen, dass die Untersuchimgen un-
set Leben (mit seinen kleinen Ausbriichen von Irrsinn) als etwas AuSergewhnli-
ches, Seltsames, in einem gewissen Sinn Unnatiirliches schildern. Auf etwas von
diesem Sinn habe ich in meinem ersten Buch Must We Mean What We Say? da-
mit reagiert, dass ich einen Essay iiber Becketts Endspiel in den Band aufnahm,
der an einem Punkt Becketts Sinn fiir die AuRergewohnlichkeit des Gewohnli-
chen mit Tschechows Schilderungen der Gewohnlichkeit des AuBergewdhnlichen
kontrastiert. Und in beiden Fillen wunderte ich mich dartiber, was wir, die wir
die verfluchte und gesegnete Féhigkeit zur Anpassung oder Konformitit haben,
als entweder gewohnlich oder als auBergew6hnlich beurteilen kénnen. (Und
dennoch kann diese Fihigkeit keine andere sein, keine anderen Krifte und Be-
schriinkungen verwenden, als unsere Fihigkeit zur Verinderung, als die, um es
mit den Romantikern zu sagen, der zu werden, der man ist — so dass der Lebens-
weg des Menschen die Resultante dieser entgegengesetaten Krifie ist.) Wenn
Witrgenstein zum Beispiel bemerkt: ,Ein philosophisches Problem hat die Form:
sch kenne mich nicht aus‘ “ (§ 123), dann verstehe ich das — in Fortsetung sei-
nes Beharrens, die Philosophie versuche, uns nichts Neues zu lehren — als die Be-
haupeung, die Philosophie fiihre uns nicht aus der Unwissenheit 2um Wissen,
sondern aus der Verwirrung oder dem Chaos zur Klarheit oder zur Ordnung, aus
dem Verirrtsein zur Selbstfindung, und der erste Schritt einer philosophischen
Anowort auf ein philosophisches Problem bestehe in dem Nachweis, dass wir uns
tatstichlich verirrt haben, verwirrt und chaotisch sind, auch wenn wir noch so
sehr glauben, voller Uberzeugungen zu stecken. (Thoreau spriche davon, dass un-
ser Uberzeugtsein charakterisiert sei durch unsere aufgeawungenen Gewissheiten
und Uberzeugungen. Und wenn uns im niichsten Abschnitt der Untersuchungen
(§ 124) gesagt wird, dass die Philosophie yalles lift, wie es ist", so lese ich das als
Hinweis auf das, was Heidegger unter Offenheit als ,Sein-lassen" versteht, nim-
lich als die kritische Bemerkung, dass die Philosophie auf den Plan gerufen wird
durch unsere Unfihigkeit, die Dinge so zu lassen, wie sie sind, d.h. durch die
Gewale unseres Denkens.)
2. Erstausgabe New York: Scribner 1969.
DAS WITTGENSTEIN’SCHE EREIGNIS 29
In dieser Folge von Gedanken iiber das Gewdhnliche bringt jede Weise, in der
wir beim Philosophieren darauf stoRen, dass wir unsere menschlichen Vermigen
Jeugnen, eine Zisur in einer unabgeschlossenen mythologischen Beschreibung
unseres Alltagslebens hervor ~ als lebten wir im Exil, als machten wir uns selbst
zu Fremden oder konstruierten einen unbeftiedigenden Ersatz fiir eine eingebil-
dete verlorene Harmonie, oder als behaupteten wit gewaltsam cher eine durch
Metaphysik garantierte Einzigartigkeit, als dass wir uns unsere Worte und Taten
zu eigen machten: ,Aber der Andre kann doch nicht DIESEN Schmerz haben!*
(sich an die Brust schlagend) (§ 253). Fiir Philosophen, die mit Nietzsches Wor-
ten im Widerspruch zur Gegenwart leben ~ eine Umformulierung der Selbstbe-
schreibung Emersons als jemanden, der Widerwillen fiir seine Gegenwart emp-
findet — und die die Wahrnehmung dessen, was sie flir die tatsichliche Welt hal-
ten, mic der Vorstellung einer miglichen Welt verbinden, gibt es, so kénnte man
sagen, zwei gewohnliche, einander entgegengesetzte Ansichten menschlicher
Méglichkeit oder Aneignung: Platon nenne sie Tiuschung und Wirklichkeit,
Kant stelle sie als die sinnliche und die intelligible Welt dar, Emerson spricht vom
Schauplatz der Konformicit und der Autarkie, Nietzsche von Philistertum und
Selbstiiberwindung, Heidegger von der durch das Eigentliche gewandelten Welt
des Uneigentlichen. Wittgensteins Versprechen von ,Frieden" oder ,Ruhe" nach
det Ruhelosigkeit ist, wie er es praktiziert, etwas, was kaum gefunden schon wie-
det verlorengeht, es ist kein Versprechen, das einen Zuufluchtsort projiziert. Seine
philosophische Haltung des Widerspruchs und der Unzufriedenheit setzt so tat-
sichlich eine Unabhingigkeit von jedweder Welt voraus, als die sich diese unvoll-
kommene enthiillen mag. ‘
Die Besondetheit der Zisuren in Wittgensteins Mythologie des Gewohnlichen
erzeugt das Bewusstsein einer andauernden Anstrengung, das Aufergewhnliche
in der Gewohnlichkeit unseres Lebens zu erkennen und umgekehrt ~ nennen wit
es cine Anstrengung, ein Bewusstsein von unserer ,Lebensweise oder eine Ein-
sicht in sie 2u bekommen. Bestitigt sche ich diese Anstrengung durch das, was
ich schon frither anlisslich der Charakterisierung der Philosophischen Untersu-
chungen als eine Art Kulturphilosophie (in ,Declining Decline*) und als ein Por-
trit des modernen Subjekts (in ,The Znvestigations’ Aesthetics of Itself") gesagt
habe.’ Uber diese beiden Charakterisierungen méchte ich noch das eine oder an-
dere Wort sagen.
Meine Vorstellung von Wittgensteins Untersuchungen als Reaktion auf ihre
Kultur, als deren Beschreibung und Kritik (die ich dort neben Spenglers Reaktion
in Der Untergang des Abendlandes stlle, einem Text, von dem bekannt ist, dass er
auf die Europier der Generation Wittgensteins und Heideggers einen dezidierten
Eindruck gemacht hat), zielte darauf ab, ihre Abschnitte, ihre Briiche und Konti-
3 Anm. d. Hesg.: ,Declining Decline* findet sich in: Stanley Cavell, This New Yet Unapproachat
‘America. Albuquerque: Living Batch Press 1989, S. 32-75. Der awveite Aufsatz findet sich in Ste-
phen Mulhall (Hg.), The Cavell Reader. Oxford: Basil Blackwell 1996, S. 369-389.
30 STANLEY CAVELL,
nuititen als Fragmente zu begreifen, welche die Einzelheiten einer vollstindigen,
komplexen Kultur darstellen. Ich war folglich geneigt, ihre Bewegung zu charak-
terisieren als eine ,vom Schauplatz und den Folgen von Tradition, Unterweisung
und Faszination [das Kind beobachtet die Erwachsenen], der Bitte um einen Ap-
fel und des Baus dessen, was als das erste Gebiiude erscheinen mag, zu der Még-
lichkeit, den Kontakt als solchen zur Tradition zu verlieren (wie in der Meditati-
on iiber ,sehen als“); und diese Momente als Spuren des Ringens det Philosophie
mit sich selbst [zu schen], mit dem Verlust und der Verinderung der Lebenswei-
se, den chronischen Ausbriichen von Wahnsinn“’. Im weiteren réume ich dann
cin, es sei nicht klar, ob wir uns die Philosophischen Untersuchungen als ein solches
Portriie vorstellen kénnen, fiige allerdings auch hinzu, dass es nicht essentiell
schwieriger sein sollte, als Wittgenstein Anweisung zu folgen: ,Fasse dies [niim-
lich eine aus vier Wértern bestehende Sprache] als vollstindige primitive Sprache
auf, wenn man, wie ich, annimmt, dies bedeute, sie als Ausdruck einer vollstin-
digen (primitiven) Kultur aufzufassen. (Das ist Teil der Bedeutsamkeit meiner
Schilderung, dass ich mir vorgestellt habe, die Bauleute bewegten sich und sprii-
chen trige, so wie ich mir vorstelle, dass friihere Hominiden sich bewegen und
kommunizieren, wobei ich annehme, dass das, was wir unter einer Kultur verste-
hen, die Selbstdarstellung ihrer Mitglieder formt, angefangen von ihrem Gang bis
zu ihren Angsten, von ihren Neigungen bis zu ihrem Ausdruck von Befriedi-
gung,) Als einen — ob nun wirklichen oder vorgestellten - Unterschied in meiner
Interpretation der Untersuchungen sollte ich klar herausstellen, dass, wenn ich,
wie soeben, die Gestalt des Kindes hervorhebe, ich damit eine Gestalt betone, die
nicht nur zu Beginn des Wittgenstein’schen Textes auftaucht, sondern weitaus
hiiufiger als an den circa 2wlf Stellen, die im Index nachgewiesen werden, nim-
lich in den wiederholten Riickgriffen auf die Vorstellung vom Lehren, Lernen,
Unterrichten, Mitteilen, Hinweisen, Ordnen und Anweisungen geben.
_ Wie wir uns die Behandlung vorzustellen haben, ist eine schicksalsschwere
Frage, die zum Beispiel von nichts weniger als Wittgensteins Antwort auf den
Skeptizismus abhingt. Wenn Saul Kripke die von mir als Unterweisungsschau-
placz der Untersuchungen bezeichnete Passage — ,Habe ich die Begriindungen er-
schépft, so bin ich nun mal auf dem harten Felsen angelangt, und mein Spaten
biegt sich zuriick, Ich bin dann geneigt zu sagen: ,So handle ich eben‘. — inter-
pretiert, so geht er davon aus, dass die Macht in diesem Streit ganz auf einer Seite
liegt, auf der des Lehrers, desjenigen, der es unternimmt, fiir die Kultur 2u spre-
chen, und da sie als die Macht, jemanden auszuschlicRen, betrachtet wird, gehe
ich davon aus, dass sie hier, wie ich gesagt habe, als Ausdruck politischer Macht
gesehen wird, Kripke bezieht sich auf Wittgensteins Phantasie, dass, ,reagiert cin
Kind auf eine suggestive Geste (des Untertichtens) nicht, so wird es von den an-
deren getrennt und als schwachsinnig behandele". Dieser Gedanke wird in Witt-
gensteins Braunem Buch angeschnitten (einer von awei erkennbaren Gruppen von
4 Stanley Cavell, This New Yet Unapproachable America. Albuquerque: Living Batch Press 1989,
DAS WITTGENSTEIN'SCHE EREIGNIS 31
Skizzen fiir die Philosophischen Untersuchungen), aber, wie ich glaube, in den Un-
tersuchungen nicht wieder aufgenommen. Ich habe ihn Wittgensteins Swift’schen
Vorschlag genannt, womie ich, wie ich meinte recht offenkundig, sagen wollte,
dass Wittgensteins Haltung zu dem Vorschlag grob derjenigen von Jonathan
Swift 20 seinem, Swifts, bescheidenen Vorschlag gleicht, man mige doch, ,um zu
verhindern, da die Kinder der Armen in Irland ihren Eltern oder dem Land zur
Last fallen, und um sie einem affentlichen Nutzen auzufiihren*, ein Kriterium zu
dem Zweck aufstellen, einen gewissen Teil von ihnen in einer bestimmten Le-
bensphase auszusondern und auf den Speiseplan 2u stellen. Damit will ich nicht
sagen, dass Wittgensteins Beschreibungen oder Entdeckungen auf diesem Gebier
nicht die Frage nach der Machtverteilung innerhalb einer Kultur aufwerfen — das
tun Swifts -, sondern nur, dass sie diese nicht kkiren, dass sie nicht kliren, wie
nahe unsere Behandlung der Hilflosen an Swifts Vorschlag heranreicht,
In seiner Version des Unterweisungsschauplatzes paraphrasiert Kripke diesen
letztlich als die Ankiindigung: ,Dann bin ich berechtigt zu sagen: ,Ich bin ge-
neigt, das zu tun’ “ (eine, wie ich fiir wichtig halte, Paraphrase, die Witrgensteins
Formulierung entgegenstcht), und sieht darin eine siarke Geste, dic so etwas be-
inhaltet wie ,Handle wie ich oder trage die Folgen". Ich bestreite nicht die Még-
lichkeit. Aber ich halte es fiir wenigstens ebenso plausibel, dass das, was Wittgen-
stein tatsiichlich schreibt, niimlich: , Ich bin dann geneigt 2u sagen: ,So handle ich
eben‘ “, worunter miglicherweise gar nichts gro Gesagtes vorzustellen ist, nur
cine schwache, ja abwartende Geste ist, die so etwas beinhaleet wie Ich habe im
Moment keinen blassen Schimmer, wo und wie ich mich verstindlicher machen
kann, doch sollte es dich irgendwann mal wicder interessieren, dann bin fiir dich
da." Anders formuliert, ich sehe nicht, warum der Fall, verallgemeinert man ihn,
zu einer Vermutung, geschweige denn zu einer These iiber den Skeptizismus
ihre, denn mir scheint, dieser kleine Mythos der Unterweisung fordert uns auf,
die Krisen oder Grenzen des Letnens Fall fiir Fall anzugehen und uns zu fragen,
wie wichtig es ist, in den verschiedenen Bercichen unserer Lebensform oder Le-
bensformen ibereinzustimmen, wie sehe wir tibereinstimmen, und wo wir Unter-
schiede tolerieren kénnen, sollten oder miissen, ja vielleicht sogar unser Leben au
indern ~ oder die Folgen zu tragen haben,
Eine Illustration durch mythologische Beschreibungen hat Grenzen, Fir Witt-
gensteins — nicht aber, wie schon gesagt, fiir Austins ~ Philosophieren ist es we-
sentlich, eine gewisse philosophische Verwundbarkeit durch oder ein Insistieren
ire wie
auf Unsinn zu erkliren, als ob die Fahigkeie, Sinn zu zerstéren, dieselbe w:
die, Sinn zu stiften, und als diente sic ihren eigenen Zwecken. Ich werde hier niche
wiedetholen, wie ich, im Zusammenhang mit der Grammatik, die Aufgabe von
Kriterien in den Untersuchungen auffasse ~ das habe ich in meinem Buch Claim of
Reason’ getan —, sagen michte ich lediglich, dass Wittgensteins Vorstellung von
einem Kriterium die Tiefe unseres gemeinsamen Sprachgebrauchs und zugleich
5 Stanley Ca
spruch der Vernunft. Prankfure am Main
ell, Claim of Reason. Oxford: Clarendon Press 1979. Deutsche Obersetzung Der An-
Suhrkamp 2006,
32 STANLEY CAVELL
unsere Macht, dieses Erbe auszuschlagen, erkkiren soll, bew., wie ich formuliert
habe, die Méglichkeit und die immer wieder aufiretende Bedrohung oder die Ko-
sirenz des Skeptizismus, Im Besitz von Kriterien au sein heift auch, im Besita der
dimonischen Macht 2u sein, sie von uns abauldsen, die Sprache gegen sich selbst
zu tichten, 2u erkennen, dass ihre Kriterien in Bezug auf andere rein iuerlich
sind, in Bezug auf Gewissheie blind, in Bezug auf unsere Fahigkeit, mit unseren
Begtiffen in neuen Zusammenhingen zu arbeiten, ginzlich unbegriinder.
Unseren geschickten Umgang mie Kriterien demonstriert Wittgenstein an ci-
ner Reihe von Beispielen (oder Erinnerungen), die manchmal so schliche sind wie
das Beispiel, jemanden zum Tee zu erwarten (wofiir unsere Kriterien so offen-
sichtliche und verschiedene Sachen wie auf die Uhr schauen, den Wasserkessel
aufsetzen und den Tisch decken sind, welche die weniger schlichte Frage des Be-
stehens eines Kontextes beinhalten, in dem jemand 2u erwarten ist), Dinge, die,
wie uns au verstehen gegeben wird, mit Kriterien fiir das Schaffen einer Erwar-
tung verbunden sind oder mit solchen fiir eine spontane Einladung oder eine 26:
getliche Annahme und dafiir, jemanden ungeduldig zu erwarten und enttiuscht
zu sein, wenn jemand nicht komme usw. Doch zugleich enthiille Wittgenstein
unsere Macht, die Kraft solcher Kriterien bei der Beurteilung der Welt in Frage
zu stellen, z. B, indem sich uns die Frage aufdringe, ob Erwarten nicht eigentlich
cin besonderes Gefithl ist (etwa dasjenige, was sich einstellt, wenn wir zusammen
mit anderen im Dunkein darauf warten, dass das Geburtstagskind die Tiir 2u sei-
net Uberraschungsparty éffnet), so dass entweder der durch das gewohnliche
Wort erwarten" ausgedriickte Begriff in seinem Bezug auf eine Vielfalt von Ver-
haltensweisen im Grunde vage oder stark konventionell ist, oder dass es in Wahe-
heit so etwas wie erwarten niche gibt, allenfalls cine Reihe von unbenannten und
Vielleicht unbenennbaren Neigungen. Wenn ich 2u mir sage: ,Dennoch, ich
wei, was erwarten ist, bewege ich mich am Rande einer geistigen Krise. Nicht
ich bin es, der dies wei8. Das ist erwarten. Jeder weil dies. Ausgenommen offen-
sichtlich einige Leute.
Angesichts dieser unserer Selbstisolation oder Selbstvergessenheit kommen mir
manchmal einige von Wittgensteins beriihmeen Augerungen der Kritik wenig
hilfreich vor — etwa wenn er davon spricht, dass wir mit dem Kopf gegen die
Grenzen der Sprache anrennen oder uns von der Grammatik tiuschen lassen —,
welche die Vermutung bei sich fithren kénnten, dass diese Grenzen und das, was
er unter Grammatik versteht, festgelegt sind. Da neige ich doch eher dazu, in den
Untersuchungen andere Merkmale dessen zu betonen, was ich als ihre implizice
Skizze des modernen Subjekts angesprochen habe, namlich eines, das den philo-
sophischen Bestrebungen und Verwirrungen unterliege, wie sie in den Quasi-
Fragmenten der Untersuchungen dargestellt werden. Diese weiteren Merkmale
scheinen mir mein Interesse an Wittgensteins ‘Text besser herauszubringen. Ich
gehe hier von der Vorstellung, dass die Untersuchungen ein Portriit unserer Kultur
sind, zu der Vorstellung itber, dass sie ein Portriit dessen sind, was ich das moder-
ne Subjekt nenne.
DAS WITTGENSTEIN’SCHE EREIGNIS 33
Im Laufe meiner Arbeit an dem Aufsatz ,The Investigations Everyday Aesthe-
tics of Itself habe ich vorkiufig ache oder neun Kennzeichen identifiziert, die der
‘Text, so wie es aussicht, diesem Subjekc beilegt. Ich habe bereits einschkigige Pas-
sagen zitiert, in denen von Verlorenheit, Exil, Verwiistung die Rede war, und nun
fiige ich viertens Seltsamkeit hinzu (,Diese seltsame Auffassung [davon, was ein
Name ist] riihrt von einer Tendenz her, die Logik unserer Sprache 21 sublimieren
—wie man es nennen kénnte", § 38), die ich als den Wunsch begreife, auBerhalb
von Sprachspiclen zu sprechen, fiinftens, ein Gefiihl von Enttiuschung iiber die
menschliche Sprache oder iiber die Kriterien, die wir miteinander teilen, weil wir
cine Welt miteinander teilen (,daf der Name eigentlich Einfaches bezeichnen soll,
§ 39), das sechstens zusammiengehit mit Verdrehtheit (,Aber warum kommt man
auf dic Idee, gerade dieses Wort zum Namen machen zu wollen, wo es offenbar
kein Name ist? — Gerade darum', ebd.); was annehmen liisst, dass siebtens
Krankheit (,Der Philosoph behandelt eine Frage; wie eine Krankheit*, § 255)
sowohl als Krankheit des Verstandes wie auch als Krankheit des Willens begriffen
wird (Philosophische Probleme ,werden durch eine Einsiche in das Arbeiten un-
seter Sprache geldst (...]: enigegen einem Trieb, es miBzuverstehen", § 109); ein
achtes Kennzeichen des Subjekts ist die Furcht zu ersticken (,Das Ideal, in unse~
ren Gedanken, sitat unverrtickbar fest, Du kannst nicht aus ihm heraustreten. (..
drauBen fehlt die Lebensluft", § 103); und ein neuntes ist schlieBlich die Qual
(,Die cigentliche Entdeckung ist die, [..J die die Philosophie zur Ruhe bringt, so
daf sie nicht mehr von Fragen gepeitscht wird, die sie selést in Frage stellen",
§ 133) — auch wenn, worauf ich bereits hinwies, die Rube wieder verloren 2u sein
scheint, sobald sie gefunden wird. Den Trieb, auBerhalb von Sprachspielen zu
sprechen, habe ich in The Claim of Reason auch als den Trieb bezeichnet,
schlechtweg zu sprechen, und war in Anlehnung an Witrgensteins Bemerkung in
$47: yEs hat gar keinen Sinn von den einfachen Bestandteilen des Sessels
schlechtweg' zu reden." Wie haben wir nun das aufzufassen, was sich in den Un-
tersuchungen als unser Trieb, Sinnloses von uns zu geben, darstellt, als unsere
teuflische Gefahr, uns hinrei®en au lassen? Das erste Mal habe ich mich dieser
Frage — der, wie ich friiher einmal formulierte, Frage nach der Ruhelosigkeit des
endlichen Geschdpfes, das mit dem Bediirfnis nach dem Unendlichen (oder mit
unendlichen Bediirfnissen) geschlagen ist ~ in ,The Availability of Wittgenstein’s
Later Philosophy augewendet, indem ich (mindestens) zwei Stimmen in den
Philosophischen Untersuchungen ausmachte: ,Die Antagonisten in Wittgensteins
Dialogen sind die Stimme der Versuchung und die Stimme der Richtigkeit*."
Man hat hier vorgeschlagen, aus der ,Stimme der Richtigkeie* die ,Stimme der
Korrektur" zu machen. Kein schlechter Gedanke. Nur, wenn man auf diese Wei-
se cher die Ahnlichkeit der Gesellschaft mit einem Gefingnis als mit einem Klas-
senzimmer betont, kénnte man zu sehr darauf zucreiben, die Macht zwischen den
Generationen zu fixieren, die Macht, neue, widerstrebende Sprecher unserer
6
ley Cavell, Must We Mean What We Say? A Book of Eszays. Cambridge: Cambridge University
Press 1976, S. 71.
34 STANLEY CAVELL,
Muttersprache 2u rekrutieren, denn die Gesellschaft wurde, mehr oder weniger
iberzeugend, auch mit einem Spital, einem Tollhaus, einem Zirkus, einer Herde,
einer Hille, einem Kaleidoskop, einem Chor, einer Meute, einem Kérper, einer
Spielhalle verglichen. Jedenfalls sollten die Stimmen niche das erschépfen, was ich
das moderne, in und vom Text skizzierte Subjekt nenne, das zudem fihig ist, sei-
nen Humor, sein Pathos, seine Parabeln, seine Aphorismen und Etholungspausen
von seinen widerstreitenden Stimmen hervorzubringen und zu schiitzen.
Ein jiingeres Beispiel fiir meine forewihrende Bemiihung, die menschliche
oder sterbliche Ruhelosigkeit festzuhalten, ist, in Wittgensteins hiufig zitierter
Berufung auf Lebensformen 2wischen einer sozialen, konventionellen oder hori-
zontalen Richtung (in der die Unterschiede zwischen ein Mahl oder einen Imbiss
cinzunchmen von Bedeutung sein kénnen) und einer biologischen, natiirlichen
oder vertikalen Richtung zu unterscheiden (fiir die Unrerschiede zwischen essen
und fiittern oder Tischen und Trégen einschligig sind). Die Bedeutung dieser
Unterscheidung kénnte, jenseits der Warnung, sich vor einer, wie ich meine, tib-
licheren und allzu konventionellen Rezeption Wirtgensteins zu hiiten (die sich
mehr auf unsere Féhigkeit konzentriert, Sprachspiele zu konstruieren, als auf un-
seren Wunsch, sich von der Enttiuschung tiber unsere Konstruktionen zu befrei-
en), deutlich werden, wenn wir Wittgensteins Idee zu Leibe riicken, die Philoso-
Phic stelle, was immer sonst noch, eine Form der Naturgeschichte des Menschen
dar (was aus den Untersuchungen insbesondere durch die fiir ein philosophisches
Werk bemerkenswerte Anzahl der darin erwihnten Tiere und Insekten ersichtlich
wird, von der liege und dem Lowen bis 2u dem einen oder anderen Kafer, einer
Gans, einem Hund und zwei Kithen); denn die Unterscheidung von Richtungen
in den Lebensformen liisst darauf schlieRen, dass der Mensch (nicht nur in seiner
Epistemologie) das unnatiirliche Tier ist, geschlagen mit einer chronischen Un-
zufriedenheit tiber sein Los, mit Pein, Enttiuschung, Exil und all dem Ubrigen —
¢s sei denn, man méchte behaupten, der Zwang, dem menschlichen Los zu ent-
kommen, das Menschliche zu tiberwinden, Monstrositit zu riskieren, sei eben das
fiir den Menschen Natiitliche.
In Zeiten der Distanz. vom Text der Philosophischen Untersuchungen wird, so
schatze ich, ein Zuriickkommen auf den Eindruck unvermeidlich sein, dass die
von mir betonten Fragen des Mythos und des symbolischen Ausdrucks eigentlich
Fragen des Stils sind. Dann erinnere ich an zwei Passagen aus dem, was als Teil II
der Philosophischen Untersuchungen erscheint. Erstens: ,Ich méchte sagen, dats,
was hier aufleuchtet, nur so lange stehen bleibt, als eine bestimmte Beschiftigang
mit dem betrachteten Objekt dauert’;’ und dann ist eine Beschreibung der be-
stimmren Beschiiftigung gefordert. (Angedeutet ist hier zugleich, dass Philosophie
niche etwas fiir jede Stimmung ist.) Zweitens: ,Ist denn auch nur unsere Malwei-
se willkiitlich? Kénnen wir nach Belieben eine wahlen?“ Nimmt man allerdings
7 Ludwig Winigenstein, Tractatus Logico-Philesophieus. Tagebiicher 1914-1916. Philosophische Un-
sentcangen Werke Bl). Parken Subrony oak ce, pilose
8 Ebd., S. 578.
DAS WITTGENSTEIN’SCHE EREIGNIS, 35
an, dass die Philosophie der Vernunft den besten Dienst leistet, wenn sie sich in
Verbindung mit der Wissenschaft sieht, dann wird sich das Problem des Stils
vielleicht nicht ergeben oder sich von selbst erledigen.
Nur einmal habe ich wohl versucht, etwas wie ein Argument auf den Weg zu
bringen, um zu zeigen, dass es fiir Wittgenstein, um es mal so auszudriicken, zum
Engagement der Philosophie fiir die Vernunft gehdrt, dass sie ihre literarischen
Bedingungen erklirt. (Aus einem solchen Engagement heraus kénnte man die
Logik um ihre Lage beneiden, zugleich mit ihrem Schreiben jedes Merkmal ihres
Schreibens zu erkliren, was heift, sie um ihre im vorhinein gewisse Zustimmung
dazu 2u beneiden, welches ihre Merkmale sind, was als Beginn einer ihrer Argu-
mentsketten il, wie an jedem ihrer Punkte Fortsetzungen erzeugt werden und
wann man an einem beftiedigenden Ende der Argumentationskette angelangt
ist.) Was ich etwas wie ein Argument fiir das Vorliegen des Literarischen nenne,
sagen wir fiir die von ihm gelieferte Notwendigkeit des Verstehens, ist eine Biirde
jenes Essays dartiber, was mir als Asthetik der und in den Untersuchungen cr-
scheint, wo die Vorstellung einer tibersichtlichen Darstellung, nimlich das, was
Wittgenstein als Darstellungsform seiner Untersuchungen charakterisiert (S 122),
nicht nur darauf anwendbar zu sein scheint, was er als sein unverkennbar philo-
sophisches Vorgehen der grammatischen Untersuchung bezeichnet (beispielswei-
se tiber den Begriff des Lesens oder den eines Spiels, tiber die Pahigkeit, erwas zu
tun, oder 2u wissen, wie man fortfihrt, tiber das Einfachsein von etwas, oder tiber
den Unterschied zwischen etwas sagen und geneigt oder versucht sein, etwas 21
sagen), sondern auch auf die extremen und charakteristischen Formen des Litera-
rischen in den Untersuchungen, also auf die Aphorismen und die Parabeln, wenn
er etwa schreibt: ,Der menschliche Kérper ist das beste Bild der menschlichen
Sele" oder ,Ein lichelnder Mund daehelr nur in einem menschlichen Gesiche*
(§ 583). Die Kriterien, die ich bei der Identifizierung solcher Beispiele als deutli-
che betone, sind die, dass sie Freude bereiten, eine Einheie bilden und eine Ge-
dankenlinie unterbrechen. Diese sind, davon gehe ich aus, als Kriterien verstind-
lich, die Witegenstein auch veranlassen, Beweise und grammatische Untersu-
chungen als deutlich zu bezeichnen, Demnach stellen die literarischen Leistungen
des Aphorismus und der Parabel zusammen mit den Methoden der Sprachspicle
in den Untersuchungen Beispiele fiir die Augenblicke geistigen Friedens dar, die
au erlangen Sache der Philosophie ist. Doch in den literarischen Fallen, in denen
zwar die Worte gewohnlich sind, wird fiir die Erzeugung etwas mehr verlang
ein gewohnlicher Sprachbefehl; sie setzen das Gespriich nicht fort, sondern halten
¢s, zumindest fiir den Augenblick, an. Damit ist in einem philosophischen Aus-
tausch eine Asymmetric zwischen den Rollen — natiirlich nicht immer zwischen
den Personen — bezeichnet, etwa zwischen denjenigen, die in der Position sind,
den Austausch zu erdffnen und zu beenden, und denjenigen, die dies nicht kin-
nen. (Daraus folgte, dass die knappen Formen des Literarischen in den Untersi-
chungen nur dann nicht allein fiir sie méglich, sondern sogar notwendig sind,
9 Ebd., 8. 496.
36 ‘STANLEY CAVELL
wenn nachgewiesen wiirde, dass etwas, was Wittgenstein sich vom Philosophieren
erwiinscht, auf keine andere Weise, vor allem nicht durch grammatische Unter-
suchungen, zu haben ist. Zum Beispiel ist, wie ich behauptet habe, das, was
grammatische Untersuchungen durch ihre Kriterien erreichen, enttiuschend (die
Ruhelosigkeit lst sich nicht vollstindig auf) und list darauf schlieRen, dass das
Vermégen, enttiuscht zu werden, in der Verfasstheit des Menschen irreduzibel
ist. Dass weitere grammatische Untersuchungen dieses Vermégen adressieren, ist
nicht zu erwarten.)
‘Wenn ich jedoch sage, es fihre genauso 2u Verzerrungen, den Stil der Philoso-
phischen Untersuchungen 2u unterschitzen, wie man vielleicht meinen kénnte,
dass meine Uberschiitzung dazu fihre, dann ist damit immer noch nicht gesagt,
ob der Stil der von ihm ausgedriickten Philosophie vorausgeht oder ihr nachfolgr.
Und der meine ganze Laufbahn begleitende Wunsch, meine Arbeit moge der
akademischen Philosophie Rede und Antwort stehen, bedeutet hier, dass ich es
fir richtig halte, dass Wittgenstein, wo immer auch sonst noch, in philosophische
Seminare gehért, vor allem in Seminare der analytischen Philosophie, und dass
sich seine Arbeit auBerhalb ihrer Aufmerksamkeit intellektuell nicht vollstindig
entfalten kann, Und wiederum frage ich, ob sein Werk sich innerhalb ihrer Do-
mine intellektuell vollstindig entfalten kann.
Eine Méglichkeit, die pidagogische Widerspenstigkeit von Wittgensteins Text
zu verstehen, besteht darin, seinen Zweifel an der recht grundlegenden akademi-
schen Annahme 2u betrachten, die Philosophie zerfalle in verschiedene Untersu-
chungsbereiche. (Heidegger ist der einzige Philosoph, von dem ich meine, et ha-
be sich ausdriicklich von der Vorstellung der Philosophie als einer Menge von Fa-
chern abgewandt.) Auf diesen Zweifel an der Trennung philosophischer Picher
antwortete ich, als ich kurz darauf zu sprechen kam, was die Untersuchungen als
Lésung eines philosophischen Problems betrachten, niimlich etwas, das zu einer
sthetischen Interpretation auffordert oder einkidt; und ferner, als ich, noch
knapper, behauptet habe, die von Wittgensteins Schreibstil verlangte Leiden-
schaftlichkeit oder Dringlichkeit der Einsicht — die von ihm vermittelte Aura von
Wichtigkeit, wahrend er gleichzeitig jede Wichtigkeit au zerstéren scheint ~ sei
als cine Form des moralischen Perfektionismus zu begreifen. Es ist, als erhielte
Austins Liebiugeln mit der Vorstellung der Erbsiinde, wenn er, im Originalton,
das verlorene Paradies mit Berkeleys Beispiclen vom Apfel und nicht wahrge-
nommenen Biumen in Verbindung bringt, in den Philosophischen Untersuchun-
gen cine philosophisch ernsthafte (sikulare) Fassung: menschliche Sprecher, die
immer von ungenutzten Méglichkeiten gepeinigt sind, und auf ewig niederge-
worfen, wenn sie sie ergreifen.
Zum Schluss noch ein Wort iiber Witegensteins Aufforderung, sich seine phi-
losophischen Methoden wie Therapien zu denken, von der einige Philosophen in
meinem Bekanntenkreis sich haben entmutigen lassen, da sie in Wittgensteins
Vorschlag ein Zeichen fir den Wunsch sahen, uns von dem Trieb 2ur Philoso-
phie zu heilen, Warum aber sollte man es so auffassen? ,, Wie Therapien lege na-
he, dass eine philosophische Frage oder eine philosophisch gestellte Frage Ursa-
DAS WITTGENSTEIN'SCHE EREIGNIS 37
chen haben kénnten, deren Urspriinge niche dargelege sind, und auf die eine hilf-
reiche Antwort ebensogut cine Lisung wie eine Heilung sein oder auch ebenso-
gut im Finden einer Antwort wie im Finden einer weiteren Frage liegen kénnte,
Ist es denn witklich sicher, dass die Rede von der Therapie die Philosophischen
Untersuchungen von det traditionellen Philosophie absetzen soll, statt ihren Platz
in der philosophia perennis einzunehmen, wenn auch in ihrer diskontinuierlichen
Weise? Hat nicht die Philosophie selbst, zumindest seit Platon, die Aufgabe der
‘Therapie fiir sich beansprucht baw. die der Befreiung aus den Fesseln der Tau-
schung, des Aberglaubens, der Verhexung, der Schwiirmerei und der Selbstent-
stellung? Was Wittgenstein davon unterscheidet — ¢s komme in der mythologi-
schen Selbstbeschreibung seines Philosophierens als ,Zerstéren von Lufigebiu-
den“ zum Ausdruck -, liegt in seinem Eindruck, dass philosophische Konstruk-
tionen dazu neigen, philosophische Verworrenheit ebenso zu maskieren wie auf-
zullésen, als besie jeder von uns seine eigenen zahllosen tiglichen Weisen, sich
zu verirren und Hilfe anzuerkennen, Daraus folgte, dass es mit der Philosophie
nur unter der Annahme vorbei ist, sie sei durch Metaphysik erschépft, und die
Metaphysik ibrerseits sei durch den Versuch erschépff, lie im skeptischen Prozess
erzeugten Fragen zu ldsen. Wenn die Metaphysik uns jedoch sagen soll, wie die
Dinge sind, dann kénnten anderweitig motivierte philosophische Verfahren — sa-
gen wir, solche durch Erstaunen - als metaphysisch gelten, unter ihnen vielleiche
solche, die weitere Bereiche der Naturgeschichte entdecken und auslegen.
Einige werden meinen, die Philosophie sollte ihre Finger von dem Befreiungs-
geschiift lassen oder es allenfalls in Partnerschaft mit jener wirksameren Befreiung
betreiben, wie sie sich in den Fortschritten der Wissenschaften darstellt. Ich hof-
fe, niemals bestritten zu haben, dass der Prozess der Aneignung genuinen Wissens
selbst von therapeutischem Wert sein kénnte. Aber in den letzten Jahrhunderten
ist das Biindnis der Philosophie mit den Wissenschaften, zumindest in meinem
Teil des philosophischen Waldes, nie Gefahr gelaufen, aufgelést zu werden, wiih-
rend das beispielsweise sehr wohl fiir die innige Auseinandersetaung zwischen der
Philosophie und der Kunst oder den Kiinsten galt. Die Befreiung, die fiir mich in
det Begegmung mit den Philosophischen Untersuchungen lag (nicht, dass sie sich
sofort eingestelle hitte, denn zuniichst kamen diese mir willkirlich, alles andere
als originell und oberflichlich vor), war, dass sie mich frei gemacht haben, jeder
Erfahrung oder jedem Text (in welchem Medium auch immer) nachzugehen, die
mich wirklich interessierten und meine Aufmerksamkeit auf sich 2u zichen schie-
nen, Und es war diese Freiheit, die mit meine Teilnahme an der Insticutionalisie-
ung der Philosophie in der englischsprachigen Welt wihrend der vergangenen
50 Jahre manchmal untersagen zu wollen schien (welche Griinde ich auch sonst
haben mag, ihr dankbar 7u sein). Anders formuliert: Ich habe Gelegenheit 2u der
Beobachtung gehabt, dass die Philosophie in den Philosophischen Untersuchungen
nicht auerst das Wort ergreift, sondern sensibel reagiert (dort auf einen wichtigen
Punkt in Augustinus’ Autobiographie), und habe daher die Vorstellung verinner-
licht, dass es die Aufgabe der Philosophie ist, sensibel zu reagieren, Manch einer
wird das als Ambition zu passiv finden. Ich kann mir vorstellen, dass es die Miss-
38 STANLEY CAVELL,
billigung eines anders gesonnenen Philosophen vermindert oder verschiirft, wenn
ich zum Schluss noch hinzufiige, dass mein Anspruch, die empiristische Traditi-
on der Philosophie zu beerben, sich niche darauf bezieht, Theorien empirisch 2u
beweisen oder die Begriindung dafiir zu liefern, sondern darauf, dass ich von
dem, was auch immer ich zu sagen mich bewogen fiihle, verlange, dass es fihig
sei, der Versuchung nicht zu verfallen, meiner Lebenswelt abhandenzukomme
Denn das wiitde umgekehrt die Preisgabe meiner Pahigkeit bedeuten, mir ein
Urteil tiber die Gerechtigkeit der Welt zu bilden.
‘Aus dem Englischen von Christiana Goldmann
PIERRE HADOT
Sprachspiele und Philosophie
Das Anprangern der Widerspriiche der Philosophen ist ein altes philosophisches
Thema. Es hat die Philosophen noch nie davon abgehalten, weiter zu philoso-
phicren, sie aber oft bewogen, eine Philosophie zu entwickeln, die — hochphilo-
sophisch, versteht sich — das Ende der Philosophie bringen sollte. Und diese Ver-
suche, die theoretisch die Krankheit samt dem Kranken hitten dahinraffen miis-
sen, entpuppten sich fiir diesen stets als Verjiingungskur. So wollte auch Descar-
tes den Widerspriichen der Philosophen ein Ende bereiten, indem er cine Me-
thode entwickelte, die fiir die spekulativen Schwierigkeiten eine rasche Lésung
und fiir den Geist die Freiheit bringen sollte, sich praktischen Problemen zuzu-
wenden, um ,uns so zu Herren und Eigentiimern der Natur (zu) machen.“" Und
doch erwuchsen aus der cartesianischen Philosophie die Philosophien von Male-
branche und Spinoza. Auf die Prolegomena zu einer kiinftigen Meraphysih folgte
schon bald eine noch nie dagewesene Fille der metaphysischen Konstruktionen,
darunter die Philosophie Hegels, die sich ihrerseits wieder als das Ende der Philo-
sophie prisentiert; von Marx, Nietasche, Heidegger ganz zu schweigen.
In der heutigen Zeit scheint sich dieses Phinomen bei Wittgenstein zu wic-
detholen. 1918, im Alter von neunundzwanzig Jahren, schrieb er zu: Beginn sei-
nes Tractatus logico-philosophicus:
Das Buch behandelt die philosophischen Probleme und zeigt ~ wie ich glaube -
da die Fragestellung dieser Probleme auf dem Mifverstindnis der Logik unserer
Sprache beruht. Man kénnte den ganzen Sinn des Buches etwa in die Worte fassen:
Was sich diberhaupt sagen lit, lie sich klar sagen; und wovon man niche reden
kann, dariiber mu man schweigen. ... Dagegen scheint mir die Wahrheit der his
mitgeteilten Gedanken unantastbar und definitiv. Ich bin also der Meinung, die
Probleme im Wesentlichen endgiiltig geldst zu haben.”
1 René Descartes, Discours de la méshodes dt. Vor der Methode des richtigen Vernunfigebrauchs und
der wisenschafilichen Forschung. Hamburg: Meiner 1997 (2, verb. Aull), S. 101; vgl. Descartes’
Brief an Blisabeth vom 28. Juni 1643: ,Wie ich schlieRlich glaube, da es sche nowwendig ist,
ceinmal in seinem Leben die Grundsite der Metaphysik richtig verstanden zu haben [...), 0
glaube ich auch, da@ es sehr schidlich sein wiirde, sein Begriffsvermigen oft mit ihrer Betrach-
tung 2u beschifiigen (René Descartes, Briefe, hrsg. von Max Bense, Kila Krefeld: Staufen-
Verlag 1949, S. 273).
2 Wittgenstein, Werkansgabe in 8 Biinden, Bd. 1. Tractatus logico-philosophicus, Frankfurt am Main:
Suhrkamp 1984, S. 9-10.
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5825)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1093)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (852)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (903)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (541)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (349)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (823)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (403)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Jacques Derrida Signatur Ereignis Kontext DeutschDocument31 pagesJacques Derrida Signatur Ereignis Kontext DeutschLucilla GuidiNo ratings yet
- Derrida - Phénoménologie Téléologie Théologie - Le Dieu de HusserlDocument19 pagesDerrida - Phénoménologie Téléologie Théologie - Le Dieu de HusserlLucilla GuidiNo ratings yet
- Heidegger The Fundamental Concepts of Metaphysics PDFDocument200 pagesHeidegger The Fundamental Concepts of Metaphysics PDFLucilla GuidiNo ratings yet
- Use As Form-of-Life. Agamben and The Stoics: Di Lucilla GuidiDocument14 pagesUse As Form-of-Life. Agamben and The Stoics: Di Lucilla GuidiLucilla GuidiNo ratings yet
- Emotions As Embodied ExpressionsDocument24 pagesEmotions As Embodied ExpressionsLucilla GuidiNo ratings yet
- Agamben DictionaryDocument225 pagesAgamben DictionaryLucilla GuidiNo ratings yet
- Karademir 2014 HypatiaDocument16 pagesKarademir 2014 HypatiaLucilla GuidiNo ratings yet
- The Agamben DictionaryDocument225 pagesThe Agamben Dictionarypmlickteig7117100% (8)
- Martin Heidegger History of The Concept of Time Prolegomena 1 PDFDocument337 pagesMartin Heidegger History of The Concept of Time Prolegomena 1 PDFLucilla GuidiNo ratings yet
- PohlenzDocument65 pagesPohlenzLucilla GuidiNo ratings yet
- BUTLER Rethinking Vulnerability and Resistance Judith ButlerDocument19 pagesBUTLER Rethinking Vulnerability and Resistance Judith ButlerLucilla GuidiNo ratings yet
- Il Giovane HeideggerDocument195 pagesIl Giovane Heideggerbrunomorabito100% (1)