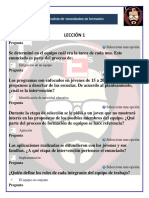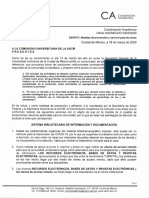Professional Documents
Culture Documents
18 2 45 PDF
18 2 45 PDF
Uploaded by
Diego0 ratings0% found this document useful (0 votes)
1 views5 pagesOriginal Title
18-2-45.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
Download as pdf
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
1 views5 pages18 2 45 PDF
18 2 45 PDF
Uploaded by
DiegoCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
Download as pdf
You are on page 1of 5
DAS SCHLANGEN-ORAKEL
Eine Seite aus dem Leben von Carl Friedrich Gau&
Der junge Carl Friedrich Gau8
(1777-1855) hat ‘Tagebuchnotizen
hiiufig codiert. Eine Kostprobe da-
von und von den Méglichkeiten, die
codierten Notizen zu entschltisseln,
war in ,Kultur & Technik" 4/1991 20
lesen, Hier nun erfolgt die weitere
Aufschliisselung einer Manuskript-
seite von Gau8, die sich bei erstem
Hinsehen jedem Verstindnis zu ent-
zichen scheint. Hinter dem genialen
Mathematiker wird dabei etwas von
dem Menschen Gaut sichtbar.
[2 Nast des sForaton der Mathe-
atiker C. F. Gauf in der Hand-
schriftenabteilung der Niedersichsi-
schen Staats- und Universititsbiblio-
thek Géttingen findet sich unter den
Aufzeichnungen teils mathematischen,
teils nicht-mathematischen Inhalts, die
seinem berihhmten Mathematischen
Tagebuch 1796-1814 beigefiigt sind,
auch eine Seite, die GauBens Vorliebe
fiir die Registrierung von Zahlergeb-
nissen beleuchtet. Zugleich zeigt die
Seite aber auch, da GauB nicht aus-
schliefllich in der Welt der Zahlen ge~
lebt hat
Die Niederscheift diirfte nach der
Beendigung seines Studiums in Gottin-
gen erfolgt sein, als er seit dem 25. 9,
1798 in seiner Vaterstadt Braunschweig
alsherzoglicher Stipendiat privatisierte
und auf Wunsch seines Sponsors, des
Herzogs Carl Wilhelm Ferdinand, an
der _braunschweigischen Landesuni-
versitit im 36 Kilometer dstlich ge-
legenen Helmstedt promovierte. In
der Hauptsache stammen die Notizen
wohl aus den Jahren 1799 bis 1801, aber
es gibt nachtrigliche Eintragungen,
zum Beispiel in den tabellarischen
Ubersichten, die bis in das Jahr 1784(!)
zurlickweisen, und spitere Erginzun-
2 genbis zum Jahr 1808
Vow Kurr-R. Bisann,
Wichtiger als die Promotion 1799
war fiir Gav das Erscheinen seine:
Disquisitiones arithmeticae 1801 in
Leipzig, begriindete er doch mit die.
sem Werk die Héhere Arithmetik und
seinen Weltruhm. Es wurde von kom-
petenter Seite noch 1978 als ,grd8tes
Wunder in der gesamten mathemati-
schen Literatur gepriesen. Neben sei-
nen fortgesetzten mathematischen Stu-
dion war Gau zur Zeit der Entste~
hhung seiner Notizen bemiiht, sich sei-
nem Lande sniitzlich* zu machen und
die Redaktion der Volkszblungen,
Geburts- und Sterbelisten im Herzog
tum zu erhalten, Er befaBte sich mit
‘Triangulationen und trat 1802 in seine
vorwiegend astronomisch orientierte
Schaffensperiode ein.
Nach dem Sieg Napoleons im Jahre
1806 tiber die vom Braunschweiger
Herzog kommandierten preuischen
‘Truppen folgte Gau8 1807 einem Ruf
als Professor der Astronomie und Di
rektorder Sternwartein Gottingen, wo
erbis zu seinem Tode blieb,
Portet des 26jthrigen Gaus,
Pastell von Christian August Schwarz, 1893
Eswar also die Zeit um die Jahrhun-
dertwende, als Gauk die Seite be-
schrieb, die hier entschltisselt werden
soll, Zunichst sol festgehalten werden,
was auf der Seite 2u sehen ist.
‘Oben auf der Seite sind Angaben
tiber einen Spaziergang vor den Toren
Braunschweigs zu finden, vor Stein~
tor bis zum Fallersleber ‘Tor mit
Schrictzahl und Zeitbedarf, der aus der
angegebenen Uhrzcit ersichtlich ist.
Gauf hat auf seinem Weg 5982 Schrit-
te, rund 4,5 Kilometer, in 54 Minuten
zurtickgelegt. Darunter in englischer
Sprache die bekannte Sentenz von
Alexander Pope unter der Uberschrift
ph", ein Beleg dafiir,
da8 die unbegrenzte Verchrung, die
Newton von Gau8 gezollt worden ist,
bereits in Gaus Jugendjahren vorhan-
den war. Die Sentenz lautet:
Nature € nature's laws lay hid
in night
God said let Newton be & all was light
(Natur & Naturgesetze lagen
verborgen in der Nacht.
Gott sprach, es werde Newton,
& esward Licht gemacht.)
Rechts dancben begegnen uns ein spie-
lerisch gemaltes ,B" und die eben-
so sorgfiltig geschriebenen Worte
»Bohnstedt® (cin Familienname) und
‘Baumannshé[hile* (im Harz)
Links davon am Rand eine Tabelle
mit der auf einem Gang am 6. 4. 1801
vom Wilhelmitor in Braunschweig zur
Eisenbiicteler Briicke und zuriick zum
Augusttor bendtigten Zeit mit einem
Marschtempo von etwa5,6 Kilometern
inder Stunde.
Inder Mitte des Blattes hat Gaufk die
gerundete Schritt-Entfernung Helm-
stedts von Braunschweig in acht Etap-
pen festgehalten. Wahrscheinlich hat er
hier anhand einer Karte die erforderli-
che Schrittzahl von 46000 geschatzt
KuhupgTechnik2vi9e4 45
Nach exfolgtem FuSmarsch zur Uni-
versititsbibliothek Helmstedc im Jahr
1798 hat er dann an anderer Stelle die
tatsichlich bendtigte Schrittzahl fiir
die einzelnen Etappen notiert: insge-
samt fiir die Distanz zwischen Braun-
schweigund Helmstede 45053 Schritte
Rechts neben der Schrittschitzung
finden sich der spielerische Schriftzug
2Sr. Wohlgeb.*, cin mathematischer
Ausdruck, der auf den Zusammenhang
zwischen lemniskatischen und ellipti-
schen Funktionen und somit auf Ende
1799 hinweist, ferner einige Zahlen, das
Wort _,Handels", cine Abbreviatur
Hen.“ und die Worte ,hoppas" sowie
"Damiens Friedrich ist's*
In der Mitte unten, etwas nach links
verschoben, befindet sich eine Tabelle
mit Mcilenangaben von Reisen bis zum
Herbst 1799, und zwar danach unter-
gliedert, ob die Reisen zu F[us), mit
dem W[agen] oder auf dem Pfferd] aus-
geftihrt worden waren. Die Aufstel-
Tung ist in ihrer Lesbarkeit durch
nachtriglich dazwischengeschricbene,
nicht dazugehdrige Zeitnotizen beein-
twichtigt. Da aber die Summe — 228
Meilen, halb verdeckt durch die ei-
ner anderen Tabelle angeharende Jah-
reszahl 1800 - und die Teilsummen
je Fortbewegungsart c
sind, lat sich die Tabelle _,
liickenlos lesen: Insgesame
erfat_ Gau8 Reisen
tiber 132 Meilen 20
S=
—Z
Fuk, 56 Meilen mit dem Wagen und 40
Mecilen als Reiter.
Rechtsunten folgt eine weiterechro-
nologische, 1784(!) beginnende und bis
1808 erginzte Ubersicht mit den jahrli
chen Reisen in Meilen. Die Unterglie~
derung ist nicht betitelt und offensicht-
lich eine andere. In der ersten Spalve
diirfte die Gesamtzahl der Meilen aus-
gewiesen sein, die in dem jeweiligen
Jahr durchgefiihrt wurden. Die Summe
bis 1799 ergibt 239 Meilen, also 11 Mei
len mehr als in der vorerwahnten
‘Zasammenstellung. Diese Differenz
Kann damit erklirt werden, da die
Niederschrift dort im Herbst 1799 er-
folgte, wahrend die spitere das Jahr
1799 vollstindig beriicksichtigte, also
auch noch den Weg nach Helmstedt im
Dezember 1799,
Unterhalb der Mitte des linken,
Randes hat Gau8 sehr sorg-, jj
faltig das Profil einer jun- |
gen Frau gezeichnet. i
Wir wissen nicht, ee
wen er hier ys
abgebildet i
hat,
CARL FRIEDRICH GAUSS
aber wir knnen Uberlegungen anstel-
len, Am 27. 7. 1803 hatte Gaul seine
spitere erste Frau, die 23jabrige Brau
schweigerin Johanna Osthoff kennen
gelernt. Die Bekanntschaft wurde nach
cdom April 1804 vertieft und fihrce im
November zur Verlobung. ,Uber-
schwenglich ghicklich" schrieb Gauf
kurz darauf an cinen Freund: ,Seit drei
‘Tagen ist der fir diese Erde fast zu
himmlische Engel meine Braut." Ihren
Namen hat er in Schdnschrift wiede
holt auf einem Blatt mit Triangul
tionsrechnungen festgehalten. Warum
sollte er nicht analog dazu ihe Profil an
dieser Stelle skizziert haben?
Nachpriifen kénnen wir diese Spe-
kkulationen nicht, weil kein Portrait der
Kuler Technik 2/1994
schon 1809 kurz nach der Geburt des
dritten Kindes verstorbenen, von
ihrem Mann tief betrauerten und nie
vergessenen Frau tiberliefert ist. Noch
1848
lust gehdirtzu den Wunden, dieri
ganz vernarben."
Wenn wir die meisten Notizen auf
die Zeit vor 1801 datiert haben und an.
dererseits annehmen, da8 die Profil-
zeichnungim Sommer 1804 entstanden
ist, so liegt darin kein Widerspruck:
Die Positionicrung des Profils auf dem
Blatt zeigt, da es sich um cine
nachtrigliche Hinzufiigung handel.
Gau8, sehr dkonomisch in der Ausnut
zzung des relativ teuren Schreibpapicrs,
hat hiufig seine Notizen spiter durch
gte er von ihr: wlhr friher Ver-
nals:
rer
ar
Erginzungen ,zweckentiremdet®, die
in keinem Zusammenhang mit dem ur
sprtinglichen Thema stehen. Fin Blick
auf die hier zu entschiliisselnde Seite er-
weist, daB diese Sparsamkeit auf Ko-
sten der Lesbarkeit seiner Handschrif-
ten durch spitere Benutzer gehen
kann,
Unterhalb des eben diskutierten
Profils finden wir noch das Wortfrag-
ment ,oppos" sowie weitere Federpro-
ben, Zahlen und Abbreviaturen, d
rohe Skizze eines Mannes mit'G
sichtsschutz und einem Plastron in der
Hand sowie in der Mitte unten die An-
gabe 10 [Meilen zu] Pilerd,] 14 [Mei
en zu], Fu8[,] 3 [Meilen ‘mit dem]
Wfagen}, darunter das Fragment einer
ee
Zubringer
HeerstraBe baw. ae
48
Kultur Technik 2/1994
Kinnpartie im Profil. Damit ist nahezu
alles beschrieben, was eine Erklirung
zulat, und sei sie auch nur hypothe-
tisch.
Offen ist die Frage nach der Bedeu-
tung der Ortsangabe ,Schlange*. Dazu
ist auf die erwahnte Fahigkeit_von
Gauf einzugehen, wahrend eines Mar-
sches zugleich seine Schritte und die
Sekunden zu zahlen,
DaB Gaul au
cin Register .der Schrittdistanzen von
der Sternwarte [Géttingen] nach jenen
Orten, die er dfter 2u besuchen pfleg-
te", gefdhrt hat, ist von seinem »Ecker~
mann", dem Geologen und Mineralo-
gen Wolfgang Sartorius Freiherr von
Waltershausen, einst Patenkind Goe-
thes, diberliefert worden, und daf er
mehrere Sachen gleichzeitig tun konn-
te,hateram 31, 12. 1837 seinem engsten
Vertrauten, dem Altonaer Astronomen
Heinrich Christian Schumacher, be-
stitigt. Erhatte die Forderung des fran-
zisischen Astronomen Joseph J.deLa-
lande gelesen, ein praktischer Astro-
nom miisse in der Sckundenzihlung so
sicher sein, daf er dabei gehen, beob-
achten, schreiben und sogar sprechen
kénnen miisse, ohne die Zahlung.ir-
gendwann zu unterbrechen oder sich
darinzu irren,
Diese Lesefrucht veranla8te nun
Gaus in dem an seinen Intimus gerich-
teten Brief zu folgender Bemerkung:
Ich kann noch viel mehr als das, ich
Kann wahrend desSekundenzahlens an
ganz andere Dinge zusammenhiingend
denken oder eine zweite, von den Se-
kunden ganz unabhingige Zihlung
machen, auch ein Buch oder einen Brief
lesen... aberdas/etztevonLalande kann
ich nicht. Ich darf nicht sprechen, we-
nigstens nicht mehr als ein paar Worte,
‘ohne aus dem Zahlen zu kommen."
So darf man iiberzeugt sein, da
Gau8 auf dem Weg zu seinem im rand
36 Kilometer entfernten Helmstedt
wohnendenDoktorvaterJohannFried-
rich Pfaff tatsichlich die oben bereits
cerwihnten 45053 Schritte in 370 Minu-
tengezahlthat.
Dreimal stoSen wir bei der hier in-
terpretierten Seite, aber auch anderwei-
tig bei GauB belegt, auf die merkwiirdi-
ge Ortsangabe .Schlange*: Oben auf
der Seite in den Notizen iiber einen
in spateren Jabren
Schematische Lokalisirung des letzten
Steins in der Schlange™ im System der Stadt-
befertigung von Braunschweig vor der
Schleifng der Befestigungsanagen ab 1802.
Gang vor den Toren Braunschweigs,
der am Steintor bei dem gletzten Stein
in der Schlange* begann und am Fal-
lersleber Tor am ,Stein in der Schlan-
ge" endete, sowie in der mit ,Ende der
Schlange" beginnenden Ubersicht mit
der gerundeten Abschitzung der
Schrittdistanzen zwischen ache Etap-
pen auf dem Wege von Braunschweig
bis Helmstedt. Die Deutung dieser Be~
rnennung gestaltete sich schwieriger als
erwartet.
‘Zunachstist die Schreibung,,Schlan-
ge" unsicher. Wie die Abbildung der
Seite zeigt, kénnte es auch ,Schlenge*
hei8en, Die Konsultierung von deut-
schen Universal- und Regionalworter-
biichern ergab keine befriedigende
Entscheidung zugunsten der einen
oder der anderen Lesung ~ es fehle
durchweg das Stichwort Torschlan-
ge" oder .Thorschlange", ebenso das
Stichwort ,Torschlenge* oder ,Thor-
schlenge*. "Es zeichnete sich Unent-
scheidbarkeitab.
Unvermutet kam die Lésung von
dem emeritierten Universitatsprofes-
sor Giinther Garbrecht in Lagesbiittel,
der eine Kopie einer 1913/14 von dem
Geometer Helves bearbeiteten Karte
zur Verfiigung stellte, die auf jum
1750* datierten Quellen beruht.
Die Karte zeigt, da® von jedem
der sicben Tore Braunschweigs eine
Briicke iber den Festungsgraben zu ci-
nem Sperrwerk gefiihrt hat, von wel-
chem cine 2weite, kiirzere Briicke ber
einen schmaleren Seitenzweig des Fe-
stungsgrabens ging. An das Ende jeder
der kiirzeren Briicken schlo8 sich ein
siebenmal ausdriicklich als Thor-
schlange bezsichneter geschlingelter
Weg an, welcher zu einer der ,Heer-
strafen* fihrte. Die ,Torschlange“ en-
dete dort, wo die Giacis genannte ab-
geflachte’Erdaufschiittung authérte,
das hei8t an der Grenze der Festung
Das wird durch die schematische, prin-
zipiell fir jedes der sieben Stadtiore
zutreffende Skizze auf Seite 48 ver-
deutlicht.
Der Karte ist zu entnehmen, daB die
Entfernung des ,Endes der Schlange
yom inneren Stadttor rund 250 Meter
betrug. Das stimmt in etwa mit dem
{ yon Gau® am 64.1801 angegebenen
E Zeithedarf ftir das Passieren. 2weier
2 Toranlagen tiberein—3,5 bzw. 3 Minu-
§ ten,
= Dont, wo sich das ,Ende der Schlan-
2 ge" — stadtauswirts geschen — befand,
i
istlogischerweiseauch ,der letzte Stein
in der Schlange* zu lokalisieren. Wo es
einen sletzten* Stein gegeben hat, miis-
sen mehrere Steine vorhanden gewesen
sein. Worin kénnte ihre Funktion be~
standen haben?
Es ware zum Beispiel denkbar, da
sie an Tagen groBen Andrangs am Ein
nehmerhaus mit ,Staubildung" fiir
Ordnung in der Reihe der auf Abferti-
gung wartenden Gespanne sorgen soll-
ten, Es ist vorstellbar, da die Steine
cine schnelle Annaherung an die kiir-
ere Briicke, etwa in Form eines Uber-
raschungsangriffs, verhindern sollten.
Es ist auch méglich, da die Aufgabe
der Steine in einer frihen Art ,Ver-
kchrsberuhigung” bestanden hat; und
endlich ist es denkbar, da die Steine
die ,Spur der ankommenden von der
der die Stadt verlassenden Fuhrwerke
trennen sollte, da sie also als ,Ver-
kchrsteiler“ fungiert haben,
Dasalles wissen wir nicht. Esistaber
eindeutig aus der Karte ersichtlich, da
Gauf einen gingigen Braunschweiger
Ausdruck gebraucht hat, indem er den
Nullpunke und den Zielpunkt seiner
Schrittzihlungen in der Schlange—und
nicht in der Sehlenge ciner faschinenar-
tigen Uferbefestigung etwa des Fe-
stungsgrabens ~ gefunden hat.
Das hier diskutierte Notizblatt ist
fiir die Gaufforschung insofern von
Bedeutung, als wir aus den beiden er-
wahnten Reisestatistiken von Ausfli-
gen etwa nach Peine, Heiligenstadt,
Moringen oder Hanstein erfahren, von
CARL FRIEDRICH GAUSS
denen wir auf andere Weise nicht un-
terrichtet sind. Hoher noch ist der
ideelle Wert einzuschitzen, der in der
moglichung eines Blicks in die gei-
stige Werkstatt eines jungen Genies be~
steht, welches alles auf Zahlen basierte,
mochten sie dem Erkenntniszuwachs
oder spiclerischer Unterhaltung. und
Entspannung dienen, SchlieSlich gibt
das Blatt Anka zu der Frage ob dieaut
ihm durch Gaui vorgenommene Skiz~
ierung des Profils einer jungen Frau
seine Braut darstellt, deren Portrit an-
derweitignichtiiberliefertis.. =
HINWEISE ZUM WEITERLESEN
‘Carl Friedrich GauB: Mashematsches Tagebuch
1796-1814. Ostwalds Klasiker, Band 256,
Leiprig 1985,
Kur-R.. Biermann (Firs): Carl Priedrch
‘Gau8. Der First der Mathematker” in Bee
fen und Gesprichen. Minchen und Leipzig
1950,
Kurt-R. Biermann: Wandlungen unseres Gau 8
Biles. In: Gau6-Geselschale Gitingen, Mi
teilungen Ne 28, 1991 Seiten 3-13.
DER AUTOR
Kurt-R. Biermann, Dr. rer. nat. ha~
bil und Professor emeritus, ehema-
liger Vizeprisident der Académie
internationale d'histoire des sciences,
zahltzu deninternational anerkann-
testen deutschen Wissenschaftshi-
storikern, Seitiiber35 Jahrenisterin
der Alexander von Humboldt-For-
schung titig.
KuleupgTochnikvi9%4 49
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5820)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1093)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (898)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (349)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Analisis Nivel 2Document19 pagesAnalisis Nivel 2Diego100% (3)
- Fórmula de Números Primos Beimar Wilfredo López SubiaDocument24 pagesFórmula de Números Primos Beimar Wilfredo López SubiaDiego67% (3)
- Analisis Nivel 4Document5 pagesAnalisis Nivel 4Diego80% (5)
- Analisis Nivel 1Document11 pagesAnalisis Nivel 1DiegoNo ratings yet
- OzunaDocument3 pagesOzunaDiegoNo ratings yet
- Analisis Nivel 3Document5 pagesAnalisis Nivel 3Diego100% (3)
- 35-2019-01-31-3-2015-02-10-Rabinowitz, Paul H. Laudatio Prof. Carlos Fernández Pérez (30 de Enero de 2009)Document4 pages35-2019-01-31-3-2015-02-10-Rabinowitz, Paul H. Laudatio Prof. Carlos Fernández Pérez (30 de Enero de 2009)DiegoNo ratings yet
- bk978 1 6817 4429 2ch0Document14 pagesbk978 1 6817 4429 2ch0DiegoNo ratings yet
- 2009-05-07J Proc GISA GM PDFDocument12 pages2009-05-07J Proc GISA GM PDFDiegoNo ratings yet
- Examen Algebra Lineal-2020-1 - Ok PDFDocument2 pagesExamen Algebra Lineal-2020-1 - Ok PDFDiegoNo ratings yet
- 0625 - Probabilidad IDocument3 pages0625 - Probabilidad IDiegoNo ratings yet
- Methods of Solving Number TheoriesDocument404 pagesMethods of Solving Number Theoriesאחמד סלאח כאמל100% (1)
- Milagros Sanchez ArroyoDocument3 pagesMilagros Sanchez ArroyoDiegoNo ratings yet